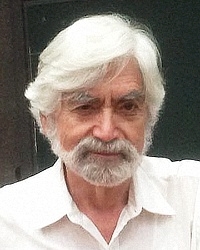Ordnung im Teilchenzoo
Nachdem man im letzten Jahrhundert viele neue Teilchen in der kosmischen Höhenstrahlung und an Teilchenbeschleunigern entdeckt hatte, zweifelte man am Prinzip der Vereinfachung in der Teilchenphysik und versuchte Ordnung in den "Teilchenzoo" zu bringen. Ausschlaggebend für die Rückkehr zur Einfachheit waren die Arbeiten der amerikanischen Physiker Murray GELL-MANN (*1929) und George ZWEIG (*1937): Im Jahre 1964 entwickelte GELL-MANN am California Institute of Technology und unabhängig von ihm ZWEIG am CERN aufgrund rein mathematischer Ordnungsprinzipien eine Hypothese für den inneren Aufbau der gefundenen Teilchen.
In dieser Hypothese wird angenommen, dass zum Beispiel die Kernbausteine, also Protonen und Neutronen keine Elementarteilchen sind, sondern aus weiteren noch kleineren Teilchen aufgebaut sind, die GELL-MANN nach einem Kunstwort in einem Roman des irischen Schriftstellers James Joyce als "Quarks" bezeichnete. Diese Wortbildung soll klar machen, dass solch merkwürdige Namen nicht auf ihren Sinngehalt zu untersuchen sind, sondern einfach als Kürzel für einen physikalischen Sachverhalt stehen. Die Quarks sind nach dem aktuellen Stand der Forschung elementare Teilchen, d.h. sie besitzen keine Substruktur und lassen sich daher nicht teilen. Wir kennen heute 6 Quarks: Up-Quark (\({\rm{u}}\)), Down-Quark (\({\rm{d}}\)), Charm-Quark (\({\rm{c}}\)), Strange-Quark (\({\rm{s}}\)), Bottom-Quark (\({\rm{b}}\)), Top-Quark (\({\rm{t}}\)) sowie deren jeweilige Anti-Teilchen, die Anti-Quarks, die mit einem Querbalken gekennzeichnet werden: Anti-Up-Quark (\({{\rm{\bar u}}}\)), Anti-Down-Quark (\({{\rm{\bar d}}}\)) und analog \({{\rm{\bar c}}}\), \({{\rm{\bar s}}}\), \({{\rm{\bar b}}}\) und \({{\rm{\bar t}}}\).
Der Überbegriff für alle Teilchen, die aus Quarks und/oder Anti-Quarks aufgebaut sind, lautet Hadronen (altgr. ἁδρός hadrós = dick, stark), denn alle Hadronen werden von der starken Wechselwirkung beeinflusst.
Das Elektron \(e\) ist ebenfalls ein Elementarteilchen. Man zählt es zur Gruppe der Leptonen (altgr. λεπτός leptós = klein, leicht), alle Leptonen besitzen keine starke Ladung und werden daher nicht von der starken Wechselwirkung beeinflusst. Zu der Gruppe der Leptonen zählt man weiterhin die zwei massereicheren „Brüder“ des Elektrons, das Myon \(\mu\) und das Tauon \(\tau\) sowie eine letzte weitere Gruppe von elementaren Materieteilchen, die Neutrinos: Elektron-Neutrino \(\nu_e\), Myon-Neutrino \(\nu_\mu\) und Tau-Neutrino \(\nu_\tau\). Neutrinos haben eine extrem geringe Masse - mehr als hunderttausendfach geringer als die Masse des Elektrons. Sie werden nur von der schwachen Wechselwirkung beeinflusst.
Wie bei den Quarks gibt es zu jedem Lepton wieder das entsprechende Anti-Teilchen, die ebenfalls mit einem Querbalken gekeinnzeichnet werden: Positron \({{\rm{\bar e}}}\), Anti-Myon \({{\rm{\bar \mu }}}\), Anti-Tauon \({{\rm{\bar \tau }}}\), Anti-Elektron-Neutrino \({{{\rm{\bar \nu }}}_{\rm{e}}}\), Anti-Myon-Neutrino \({{{\rm{\bar \nu }}}_{\rm{\mu }}}\) und Anti-Tau-Neutrino \({{{\rm{\bar \nu }}}_{\rm{\tau }}}\). Als alternative Schreibweise findet man oft: Elektron \({{\rm{e}}^ - }\), Positron \({{\rm{e}}^ + }\), Myon \({{\rm{\mu }}^ - }\), Anti-Myon \({{\rm{\mu }}^ + }\), Tauon \({{\rm{\tau }}^ - }\) und Anti-Tauon \({{\rm{\tau }}^ + }\).
Insgesamt kennen wir also 12 Quarks (inklusive Anti-Quarks) und 12 Leptonen (inklusive Anti-Teilchen) als elementare Bausteine der Materie.
Mit dem "Standardmodell der Elementarteilchenphysik" bezeichnet man eine physikalische Theorie, welche die Wechselwirkungen (starke, schwache und elektromagnetische) zwischen den bekannten Elementarteilchen beschreibt.
Hinweise: CERN bietet hier einen englischsprachigen, aber gut verständlichen Kurzfilm zum Standardmodell an.
Die Elementarteilchen der Materie
Die 12 Elementarteilchen der Materie lassen sich zunächst in drei Generation (oder auch: Familien, in Abb. 3 die drei Spalten) einteilen. Die drei Generationen beinhalten jeweils sehr ähnliche Teilchen, lediglich die Masse der Teilchen ändert sich zwischen den Generationen erheblich.
Am geläufigsten sind die Mitglieder der 1. Generation in der 1. Spalte, denn sie sind die Grundbausteine der Materie, mit der man gewöhnlich in Berührung kommt: Für den Aufbau der Nukleonen und somit des Atomkerns dienen die Quarks \({\rm{u}}\) und \({\rm{d}}\). Von den Leptonen gehört zur 1. Generation das Elektron \({\rm{e}}\), das die Hülle eines Atoms aufbaut, sowie das nahezu masselose Elektron-Neutrino \({{\rm{\nu }}_{\rm{e}}}\), das von den ß-Zerfällen her bekannt ist und auch in großer Zahl von der Sonne zur Erde gelangt.
Die Mitglieder der 2. und 3. Generation in der 2. und 3. Spalte treten nur unter extremen Bedingungen auf, wie sie z.B. in Teilchenbeschleunigern oder in den oberen Schichten unserer Atmosphäre herrschen, wo die kosmische Strahlung auf Teilchen in unserer Atmosphäre trifft. Die Mitglieder der 3. Generation besitzen im Vergleich zu ihren Verwandten eine sehr große Masse und können daher nur in Teilchenbeschleunigern nachgewiesen werden, denn man benötigt sehr hohe Energien um diese Teilchen zu erzeugen.
Man kann die 12 Teilchen aber auch nach ihrer Ladung in verschiedene Gruppen einteilen (in in Abb. 3 die drei Zeilen), wodurch ein erstaunlich übersichtliches Schema entsteht. Je tiefer die Teilchen in der Tabelle stehen, desto mehr unterschiedliche Ladungen besitzen sie:
Die elektrisch neutralen Leptonen in der 1. Zeile tragen lediglich eine schwache Ladung. Somit werden sie "nur" von der schwachen Wechselwirkung beeinflusst und tauschen "nur" die Botenteilchen \({{\rm{W}}^ + }\), \({{\rm{W}}^ - }\) und \({{\rm{Z}}}\) aus.
Die elektrisch geladenen Leptonen in der 2. Zeile tragen zusätzlich eine elektrische Ladung. Somit werden sie auch von der elektromagnetischen Wechselwirkung beeinflusst und tauschen neben \({{\rm{W}}^ + }\), \({{\rm{W}}^ - }\) und \({{\rm{Z}}}\) auch Photonen als Botenteilchen aus.
Die Quarks in der 3. Zeile schließlich tragen auch noch eine starke Ladung. Sie werden also zusätzlich von der starken Wechselwirkung beeinflusst und tauschen somit außer \({{\rm{W}}^ + }\), \({{\rm{W}}^ - }\), \({{\rm{Z}}}\) und Photonen auch Gluonen als Botenteilchen aus.
Die folgende Abbildung zeigt noch einmal die für uns wichtigsten Elementarteilchen der Materie der 1. Generation.
Die Elementarteilchen der Anti-Materie
Ein entsprechendes Bild ergibt sich für die jeweiligen Anti-Teilchen, hier sind lediglich alle Ladungen umgekehrt, statt einer elektrischen Ladung von \( + \frac{2}{3}\) trägt das Anti-Up-Quark zum Beispiel eine elektrische Ladung von \( - \frac{2}{3}\). Aus Symmetriegründen erfolgt die Einteilung nach Ladungen in den verschiedenen Zeilen nun aber umgekehrter Reihenfolge.
Die folgende Abbildung zeigt schließlich noch einmal die Elementarteilchen der Anti-Materie der 1. Generation.
Weitere mögliche Einteilungen der Elementarteilchen
Die Elementarteilchen lassen sich auch noch nach ihren jeweiligen starken, schwachen oder elektrischen Ladungen einteilen. Entsprechende Einteilungen findest du unter Starke Ladung (Farbladung), Schwache Ladung und Elektrische Ladung.