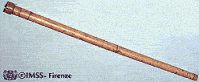Die gegenseitige Befruchtung von Technik und Physik wird am Beispiel der Teleskope besonders deutlich. Die technischen Fortschritte bei der Herstellung von reinen, schlierenfreien Gläsern und die hochausgebildete Kunst der Glasbearbeitung (Schleifen, Polieren usw.) machten den Bau zunehmend leistungsfähiger Linsensysteme möglich. Der Blick durch das Fernrohr führte und führt die Wissenschaftler zu immer neuen Ansichten über den Aufbau unserer Welt.
Aus physikalischer Sicht sollen zwei wesentliche Eigenschaften aller Fernrohre hier vorweg herausgestellt werden:
- Vergrößerung: Durch geeignete Linsensysteme wird der Winkel unter dem wir das zu beobachtende Objekt wahrnehmen vergrößert.
- Empfindlichkeitssteigerung: Der Durchmesser der Linse, in die das Licht eintritt (Objektiv) ist größer als die Eintrittsöffnung unseres Auges. Dadurch wird mehr Licht vom Objekt aufgenommen. Das Fernrohr erhöht also die Empfindlichkeit des Nachweises.
Das holländische oder galileiische FernrohrDie ersten Hinweise auf Mikroskope und Fernrohre stammen aus den Niederlanden (ca. 1600 n. Chr.). Dem Mikroskop wurde anfangs wenig Bedeutung zugemessen, während der Nutzen des Fernrohres für Seefahrt und Astronomie schnell erkannt wurde. |
Galileo GALILEI (1564 - 1642) |
Das keplersche oder astronomische FernrohrEin seinem Werk "Dioptrice" zeigte Kepler (1611), dass ein Fernrohr auch durch die Kombination zweier Sammellinsen aufzubauen ist (langbrennweitiges Objektiv; kurzbrennweitiges Okular). Die Kepler-Rohre haben gegenüber den Galilei-Rohren den Nachteil, dass die Bilder auf dem Kopf stehen (kein Nachteil in der Astronomie) und ihre Baulänge größer ist. Als Vorteile kann man die höhere Bildhelligkeit und das größere Gesichtsfeld nennen. |
Johannes KEPLER (1571 - 1630) |
| Da die Vergrößerung der Fernrohre mit der Objektivbrennweite steigt, versuchte man durch den Bau immer längerer Rohre Vorteile zu gewinnen. Um 1670 konstruierte Johannes Hevelius ein über 40m langes Rohr. In der Praxis hat es sich jedoch nicht sonderlich bewährt, da schon der leiseste Windstoß die Justierung veränderte. |
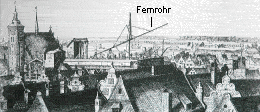 |
|
Qualität und Größe wächstDurch die Forschungen und technischen Entwicklungen des Joseph Fraunhofer aus München konnten einige Nachteile von Refraktoren beseitigt werden. Durch Linsenkombinationen aus verschiedenen Glassorten und ausgeklügelter Schleiftechnik gelang es die bisher störenden Farbfehler stark zu reduzieren. Mit einem auf Fraunhofer zurückgehenden Fernrohr konnte 1846 der Planet Neptun entdeckt werden. Nebenstehendes Bild stammt vom Deutschen Museum in München. |
 |
| Aber auch an der Entwicklung großer Spiegel wurde weiter fieberhaft gearbeitet. Eines der größten Spiegelteleskope wurde 1949 auf den Mt. Palomar in den USA eingerichtet. Der Durchmesser des Spiegels beträgt etwa 5000 mm. Mit ihm konnten Objekte im Universum registriert werden, die ca. 10 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt sind. Die Empfindlichkeit dieses Teleskops ist so hoch, dass es Objekte nachweisen kann, die so schwach strahlen, wie eine Kerzenflamme in 5000 km Entfernung. |
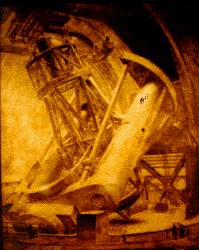 |
| Um Empfangsstörungen durch erwärmte oder verschmutzte Luft zu vermeiden, aber auch um fern von irdischen Lichtquellen zu sein (deren Licht stört bei der Beobachtung), baut man die großen Teleskope meist in größeren Höhen auf. Im Jahre 1990 transportierte ein Space-Shuttle das Hubble-Space-Teleskop mit einem Spiegel von 2400 mm Durchmesser in eine Erdumlaufbahn. Mit diesem Weltraumteleskop konnten bisher noch nicht gekannte Galaxien entdeckt werden. |
 |
|
Trotz der großen Erfolge der Weltraumteleskope liegt ein großer Forschungsschwerpunkt in der Entwicklung von sehr großen und untereinander vernetzten Teleskopen auf der Erde. Die ESO plant für ca. 2015 den Bau eines "Überwältigend großen Teleskops". Es soll einen Spiegeldurchmesser von hundert Metern haben und fast die Ausmaße der Cheops-Pyramide erreichen. Mit ihm sollen extrem lichtschwache Objekte gesehen werden können, die kurz nach dem "Urknall" entstanden sind. |
 |
Mit den ersten Fernrohren gelang es, das heliozentrische Weltbild zu festigen. Mit den heutigen Teleskopen, die nicht nur im sichtbaren Bereich arbeiten, stößt man an die Grenzen des Alls vor.